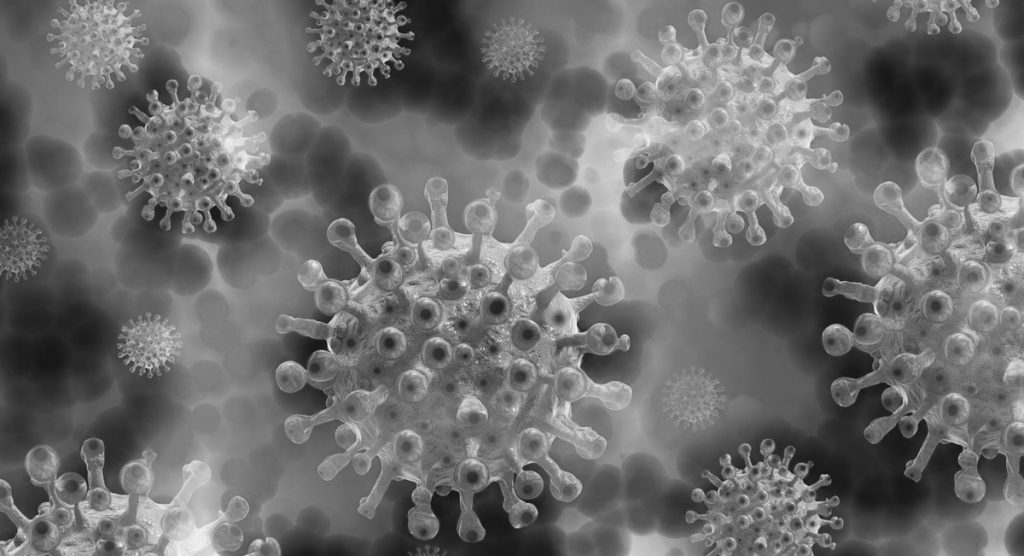Von Lothar Höbelt
„In our schools, our newsrooms, even our corporate board rooms there is a new far left fascism that demands absolute allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantra, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted and punished. It’s not going to happen to us.” – Donald Trump am 4. Juli 2020
Churchill und die „Inselrasse“
Das Denkmal Churchills in der Londoner Innenstadt – so liest man – wurde in den letzten Wochen verunstaltet, weil er doch schließlich ein Rassist gewesen sei. Sein Enkel hat sich darüber schockiert gezeigt. Das ist verständlich; doch ich bezweifle, ob Churchill selbst darüber sehr schockiert gewesen wäre. Nicht bloß, weil Churchill sich an die Devise gehalten hat: „Stiff upper lip!“ (frei übersetzt mit: Ruhig Blut bewahren!) Sondern weil Churchill nach allem, was wir von ihm wissen, auf den Beifall linker Radaubrüder nie allzu viel Wert gelegt hat. Churchill war ein Meister der Sprache – den Nobelpreis für Literatur hat er sich zum Unterschied von vielen anderen wirklich verdient. [1] Er hat nicht bloß viel geschrieben; auch viel von dem, was er sagte, wurde mitgeschrieben (am Rande vielleicht auch das eine oder andere „apokryphe Zitat“ erfunden). Da findet sich dann zweifelsohne vieles, was der „political correctness“ widerspricht, nicht bloß der heutigen (das versteht sich von selbst), sondern – zu seiner Ehre sei’s gesagt – auch schon der damaligen. Der Mann war eben ein großartiger Reaktionär – was ja noch lange nicht heißt, dass er immer recht gehabt hat. (Seine Militärs konnten ein Lied singen über so manche krause Ideen, die sie ihm nur mit Mühe auszureden vermochten.)
Churchill hielt die Angelsachsen – „our island race“ – für eine überdurchschnittlich begabte und geschichtsmächtige „Rasse“ (den Begriff Nation vermied er in dem Zusammenhang als missverständlich wohl bewusst, weil er darunter ja auch die USA und große Teile des Commonwealth verstand). Die Geschichte des Vierteljahrtausends zwischen John Churchill (dem Herzog von Marlborough [2]) und Winston Spencer Churchill bestätigt diese These; andere Epochen eignen sich dazu vermutlich weniger. [3] Im Index heutiger „political correctness“ nehmen die Angelsachsen da vermutlich eine mittlere Position ein. Würde ein Deutscher Ähnliches von seiner Nation behaupten, wäre der Schnappatmung kein Ende (zum Teil sogar zu Recht, weil die BRD zwar mit den Guthaben ihrer Bürger fahrlässig umgeht, sich aber allzu oft in der Rolle des Lehrers Lämpel gefällt, dessen Lehren die Europäer mitnichten mit Vergnügen hören). Es lassen sich freilich auch Fälle denken, wo ähnliche Behauptungen mit schuldigem Applaus oder zumindest einem gewissen Verständnis quittiert würden.
Rassismus ohne Rassen
Damit kommen wir zu einem der Probleme mit dem Begriff „Rassismus“. Es wurde darunter wohl landläufig meist die unterschiedliche Behandlung von Bürgern auf Grund von Hautfarbe und/oder Abstammung verstanden. Die Negersklaverei in den frühen USA (es durften eben ausschließlich Schwarze versklavt werden [4]), dann die Diskriminierung, später dann Vertreibung und schließlich Ermordung von Weißen mit jüdischen Großeltern durch Hitlers Regime waren besonders eklatante Fälle. In manchen Teilen Europas gab es vorher auch schon Bestrebungen, den Zugang von Juden zu Universitäten zu beschränken: Ihr Anteil an den Studenten sollte – unabhängig von Interesse und Begabung – nicht höher sein als ihr Anteil an der Bevölkerung. Lueger hat mit solchen Ideen geliebäugelt, aber seine Partei hat derlei Regelungen nie eingeführt, auch nicht, als sie an der Macht war.
Für derlei Paragraphen regt sich heute keine Stimme mehr, oder doch? In den USA bezeichnen sich viele Universitäten ausdrücklich als „Equal opportunity“-Anstalten. Damit ist freilich keineswegs gemeint: Freie Bahn dem Tüchtigen, woher er auch kommt. Sondern ganz im Gegenteil: Der Anteil mancher ethnischer Gruppen an den Studenten und Professoren soll unbedingt auf ihren Prozentsatz in der Gesamtbevölkerung gesteigert, der anderer folglich notwendigerweise vermindert werden. Lueger lässt grüßen (nicht bloß, weil es dabei um „Schwarze“ geht). Notabene: Es gibt in den USA diverse ethnische Gruppen, wie die Chinesen (die lange mit eigenen Gesetzen diskriminiert wurden) oder die Japaner (die im 2. Weltkrieg pauschal interniert wurden), die ohne jede „reverse discrimination“ einen überproportionalen Anteil an den Bildungsschichten erobert haben. Woran das wohl liegen mag?
Wenn es um den allgegenwärtigen Vorwurf des Rassismus geht, hätten derlei „Equal opportunity“-Institutionen einen gewissen Erklärungsbedarf. Der tschechische Präsident Milos Zeman hat den Nagel auf den Kopf getroffen, als er am 4. Juli in der amerikanischen Botschaft in Prag darauf hingewiesen hat, der Slogan „Black lives matter“ (und andere nicht oder doch weniger?) sei in diesem Sinne selbst rassistisch. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass der harte Kern antirassistischer Theoretiker ja überhaupt der Meinung ist, dass es keine Rassen gibt, sondern es sich dabei bloß um „eingebildete Gemeinschaften“ handelt. Sprich: es gibt zwar keine Rassen, aber die „richtigen“ müssen dennoch gefördert werden. Derlei Paradoxien, die jeder Karnevalssitzung zur Ehre gereichen, firmieren dann unter den Rubriken „Aufklärung und Vernunft“. In den Fußnoten einschlägiger Elaborate wird zuweilen sogar verschämt auf derlei Widersprüche hingewiesen, die aber eben leider politisch notwendig seien …
„Rassismus“ und Rechtsstaat
Doch selbst, gesetzt den Fall, die Kritiker haben in dem einen Punkt recht und weiße Polizisten behandeln schwarze Verdächtige anders als weiße. Ähnliche Vorwürfe über die Voreingenommenheiten fremdnationalen Verwaltungspersonals waren ja auch unter den Nationalitäten der Habsburgermonarchie an der Tagesordnung. Dann ist es mit Quoten für Polizisten nicht getan. Die Wahrscheinlichkeit ist immer noch 7 zu 1, dass der schwarze Verdächtige auf einen Ordnungshüter trifft, der nicht seiner Gruppe angehört. Ein Viertel in Seattle hat angeblich den Vorschlag in die Debatte eingebracht, seine Bewohner würden künftig in Eigenregie für Recht und Ordnung sorgen, die (weiße?) Polizei möge fernbleiben. Das Experiment scheint nicht wirklich erfolgreich zu verlaufen. Es ist freilich auch nicht ganz so originell: Das Konzept ist unter dem Namen Apartheid längst ausprobiert worden – eine strikte Trennung von weißen und schwarzen Hoheitsgebieten. (Allerdings war die Aufteilung der Ressourcen im Falle Südafrikas extrem unfair.) Aber interessant ist schon, wie dieses Modell in Form von „No-go-areas“ (für die Polizei) plötzlich Anklang bei fortschrittlichen Gemütern findet …
In einem Punkt haben die Unterstützer von „Black lives matter“ vielleicht sogar recht: Massaker und Menschenrechtsverletzung mit schwarzen Opfern wurden von europäischen und nordamerikanischen Medien vermutlich vielfach tatsächlich nicht mit jener Ausführlichkeit behandelt, wie in vergleichbaren Fällen. Das mag mit den Gewohnheiten des Fernsehzeitalters zu tun haben: Eine Story ohne Bild ist keine Story – und in vielen afrikanischen Krisengebieten (das ehemalige Südafrika ausgenommen) waren komfortable Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels für Kameraleute eben Mangelware. Zum anderen hängt es aber vielleicht auch damit zusammen, dass es sich bei den „Tätern“ ja vielfach um fortschrittliche Regimes handelte, um Heldengestalten der Entkolonialisierung, bei den Opfern, von dem portugiesischen Verbündeten Biafra über die Ovimbundu Savimbis in Angola bis zu den Ndebele in Mugabes Zimbabwe, um „Handlanger der Reaktion“. Da gelten dann freilich andere Maßstäbe …
Weil es keine „Rassen“ gibt oder geben soll, wird der Begriff „Rassismus“ meist „weiter“ gefasst: Er bezieht sich – so heißt es – auf alle Fälle von „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“, es gehe um gesellschaftliche „Inklusion und Exklusion“. Diese Anschauung lässt sich vielleicht als gesunkenes Kulturgut des Marxismus interpretieren. Um nicht falsch verstanden zu werden: Damit soll keineswegs die lange Reihe marxistischer Kirchenväter – die ja von Stammvater Marx über die zeitweiligen Militärberichterstatter Engels und Trotzki zumeist erfrischend frei waren von politisch korrektem Schönsprech – für diverse zeitgeistige Absurditäten verantwortlich gemacht werden. Aber eine Argumentation, die alle kulturell bedingten Unterscheidungen für illegitim erklärt, ökonomische Gegensätze dagegen für (allein) legitim, verweist nun einmal auf gewisse gemeinsame Grundannahmen.
Wesentlich am Umgang mit dem Vorwurf des Rassismus ist jedoch vor allem die implizite Übertragung des Gleichbehandlungsgebots vom Staat auf den Einzelnen. Der Staat ist eine juristische Person, er hat kein Gewissen (sondern folgt der „Staatsräson“) und keine „likes“ und „dislikes“ zu haben, sondern alle seine Bürger ohne Unterschied der Hautfarbe, der Abstammung, der Religion etc. gleich zu behandeln. Der Bürger selbst muss das nicht, ja er kann es selbst beim besten Willen nicht: Man kann nicht alle seine Mitmenschen gleichermaßen „mögen“ (oder auch nicht mögen). Als staatlicher Funktionär ist der Einzelne gehalten, Verwandte nicht bevorzugt zu behandeln; als Privatmann trägt ihm dieselbe Rechtsordnung das Gegenteil auf: er ist „unterhaltspflichtig“. Die eigene Familie und Verwandtschaft hat Vorrang.
Der Rechtsstaat ist nicht dazu da, um seinen Bürgern vorzuschreiben, einander zu mögen. Er muss ihnen bloß nachdrücklich zu Gemüte führen, dass sie auch diejenigen, die sie nicht mögen, nicht an Leben oder Eigentum schädigen dürfen (und bei ihren Unmutsäußerungen jegliche Kollateralschäden für die Allgemeinheit zu vermeiden haben). Der Zwang, alle gleichermaßen lieb und großartig zu finden, führt bloß zur Heuchelei. Ein amerikanischer Satiriker, Tom Lehrer, hat derlei übereifrige Moralisten schon vor einem halben Jahrhundert in seinem Couplet „National Brotherhood Week“ aufs Korn genommen: „I know that there are people who do not love their fellow man, and I hate people like that.“ Alle Versuche, einschlägige Gesslerhüte aufzustellen, sind deshalb nicht bloß zurückzuweisen, sondern es ist ihnen vielleicht am besten mit der alten österreichischen Taktik zu begegnen: „Net amal ignorieren“.
Wahlkampfgag oder Kulturrevolution
Die Reaktionen auf den Anlassfall von Minneapolis sind in jedem Fall grotesk überzogen, einmal ganz abgesehen davon, dass auch sehr viele Weiße von Polizisten erschossen worden sind – und sehr viele Polizisten von Kriminellen aller Hautfarben, kurioserweise, ohne dass sich das europäische Parlament deshalb zu Unmutsäußerungen herausgefordert fühlte. Es ist auch von geradezu berückender Logik, einen republikanischen Präsidenten für allfällige Unterlassungssünden einer demokratischen Stadtverwaltung haftbar zu machen. Doch wie heißt es in einem bekannten Text über die sieben guten Gründe fürs Trinken: „…und siebentens jeder andere Grund“. Das gilt selbstverständlich auch für Randalierer – oder für ihre klammheimlichen Sympathisanten, die einen harmlos-populären, aber wenig begeisternden Kandidaten wie Joe Biden bei einer Klientel vermarkten müssen, die zwar traditionell demokratisch wählt, aber vom Anti-Trump-Fieber wenig erfasst ist und daher sonst möglicherweise daheim bleibt. [5]
Die nächsten Monate werden Aufschluss darüber geben, ob es sich beim unverhältnismäßigen Hochspielen dieses Themas um einen Wahlkampfgag handelt, der möglicherweise etwas aus dem Ruder gelaufen ist, oder um den Beginn einer „Kulturrevolution“ nach dem Muster Maos, die dazu bestimmt ist, alle Überlieferungen und Traditionen ihrer jeweiligen Kultur unter Generalverdacht zu stellen und über Bord zu werfen. Dementsprechend ist ja auch die Reaktion zu dosieren: Dem Aufreger fürs Sommerloch – quasi als Ersatz für Gretas Kinderkreuzzug vom Vorjahr – begegnen große Teile des „Establishments“ offensichtlich mit einer Strategie, die sich mit (zu?) viel Einfühlungsvermögen vielleicht noch als Mischung von ängstlichem Opportunismus und „repressiver Toleranz“ charakterisieren ließe: Man weicht der Konfrontation aus, verteilt begütigende Wortspenden, lobt die guten Absichten der Aktivisten und blendet die kriminellen Begleiterscheinungen weitgehend aus – alles in der Hoffnung, der Peinlichkeit damit ein schnelles Ende zu bereiten. [6] Es ist ja – jenseits aller Verschwörungstheorien – auch eher unwahrscheinlich, dass man in den Vorstandsetagen großer Konzerne, die da mit den Wölfen heulen, tatsächlich seine spontanen Sympathien für Plündererkolonnen entdeckt hat.
Oder es handelt sich, wie Trump in seiner großen Rede zum amerikanischen Unabhängigkeitstag ausgeführt hat, tatsächlich um den Anlauf einer Kulturrevolution mit totalitären Vorzeichen, um eine Bewegung, die allen mit Verfolgung und „Ausgrenzung“ droht, die nicht ihre Sprache sprechen, ihre Rituale übernehmen, ihre Slogans nachplappern und ihren Geboten folgen. Nun wird der Spruch „Wehret den Anfängen!“ zwar gern überstrapaziert. Aber man wird Trump wohl zustimmen können, wenn er postuliert: „Uns soll das nicht passieren!“ In China hat die „Große Kulturrevolution“ (samt ihren ökonomischen Begleiterscheinungen) eine in jeder Beziehung ziemlich katastrophale Periode eingeläutet. China hat allerdings das Glück gehabt, mit Deng Hsiao-P’ing – der wohl wichtigsten historischen Gestalt des 20. Jahrhunderts – eine Persönlichkeit gefunden zu haben, die diesen Irrweg korrigiert und China damit auch wieder auf den Platz zurückgeführt hat, den es als eines der Zentren der Zivilisation jahrtausendelang eingenommen hat. Bloß wo sollte die westliche Welt ihren Deng hernehmen?
Anmerkungen
[1] Wer als Besucher durch Chartwell streift, Churchills Landhaus in Kent, kann an einer Stelle hören, wie er Lob zurückwies, denn nicht ihm gebühre das Verdienst für das Durchhaltevermögen Englands im Kriege, sondern den „sterling qualities of our island race“. Churchill hat dazu einen historischen Bilderbogen verfasst – zugegeben nicht zuletzt, weil er Geld brauchte. Aber um mit historischen Darstellungen gut zu verdienen, muss man eben auch sehr gut schreiben können. Churchill konnte es. Seine „History of the English Speaking Peoples“ ist tatsächlich ein Lesevergnügen.
[2] Auch dem Stammvater scheint die Wiener Linke ans Leder zu wollen: Der Platz, der nach seinem Sieg von Hochstädt (auf Englisch: Blindheim = Blenheim) benannt ist, sollte nach dem Votum der Bezirksvertretung in Johann-Koplenig-Platz umbenannt werden. Bemerkenswert ist, dass sich auch die vermeintlichen Liberalen der NEOS diesem Votum angeschlossen haben, Michael Ludwig der Schnapsidee im Gemeinderat hingegen eine Absage erteilt hat. Sicher: Es ist Wahlkampf – dennoch: Ehre, wem Ehre gebührt…
[3] In einem der vielen Robin-Hood-Filme findet sich die hübsche anachronistische Szene, wo ein Normanne den Angelsachsen erklärt, dass sie nur mit dem organisatorischen Talent der Besatzer eine Chance hätten, tatsächlich eine Weltmacht zu werden.
[4] Für Weiße gab es bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts den Status des „indentured servant“, einer Schuldknechtschaft auf Zeit.
[5] Trump hat mit seiner protektionistischen Politik bei der Industriearbeiterschaft gepunktet, der auch ein beträchtlicher Teil der schwarzen Bevölkerung zuzurechnen ist. Sein Stimmenanteil unter den Schwarzen war deshalb höher als der seiner republikanischen Vorgänger, allerdings in keinem sehr nennenswerten Ausmaß.
[6] Ein solches Kalkül mag man – pars pro toto – z. B. der (christdemokratischen) EVP unterstellen, die im europäischen Parlament mit Mehrheit einer entsprechenden Resolution zugestimmt hat, vielleicht sogar – mit Nachsicht aller Taxen – der Redaktion einer vermeintlich bürgerlichen Wiener Zeitung, die den Beitrag eines regelmäßigen Kolumnisten zurückgewiesen hat, der sich kritisch über die momentane Hysterie äußerte.
Wenn Ihnen dieser Artikel besonders gefallen hat, können Sie uns gern eine kleine Spende überweisen: An die Genius-Gesellschaft für freiheitliches Denken, Wien, IBAN: AT28 6000 0000 9207 5830 BIC: OPSKATWW. Auch über kleine Spenden wie € 5,– oder € 10,– freuen wir uns und sagen ein herzliches Dankeschön.
Bildquelle:
- afroamerican-349806_1280: Ryan McGuire viaPixabay